
Dies ist die erweiterte Version einer Rezension, die am 23. April 2020 auf H-Soz-Kult erschienen ist.
Benjamin Nicoll, Minor Platforms in Videogame History, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2019, 211 Seiten, ISBN: 978-94-6298-828-6, 112,50 Euro (Hardcover)
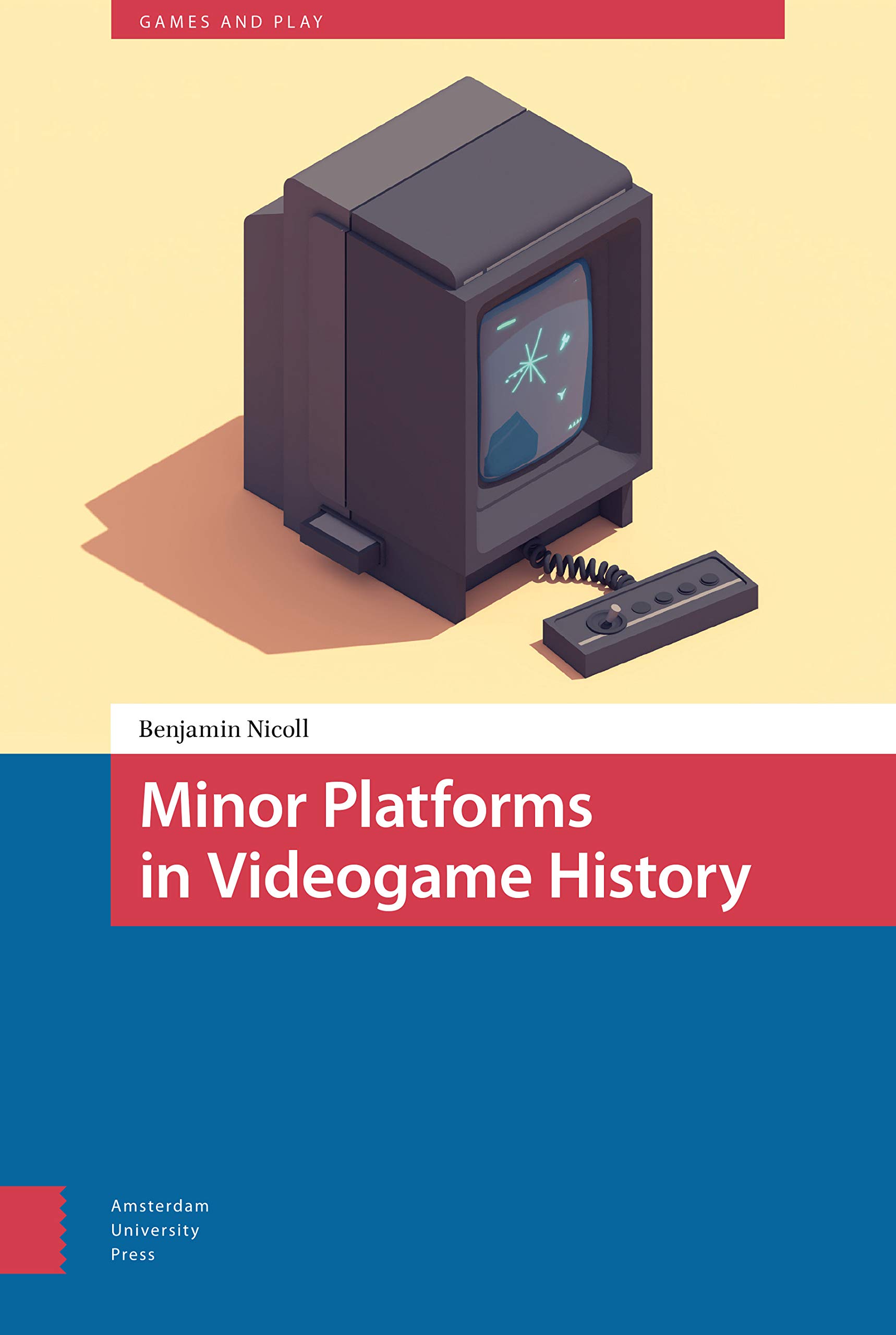 Auch wenn die jüngst entstehenden Studienprogramme und Professuren mit ihren entsprechenden Denomination den Eindruck erwecken, “Game Studies” seien ein fest umrissenes Forschungsfeld, mit einem klar abgrenzbaren Gegenstand und einem definierten Methodenset (um nicht -kanon zu sagen), handelt es sich dabei jedoch vielmehr um ein pluriperspektivisches, multimethodisches und vor allem interdisziplinäres Diskursfeld, in welchem Video- und Computerspiele mal im Zentrum des Interesses stehen und mal Anlass zu disziplinenspezifischen Forschungsfragen bilden. Die kulturwissenschaftliche Spieleforschung bildet hierbei den größten Sektor, gefolgt von der medienwissenschaftlichen und musikwissenschaftlichen Untersuchung von Spielen. Neben den synchronen Orientierungen bilden auch diachrone Fragestellungen zur Geschichte (bzw. den Geschichten) der Spiele einen wichtigen Forschungs- und Studienfokus. Die Historiografien zeigen sich jedoch allzu oft von ökonomischen Motiven angetrieben und sind strukturiert von marktwirtschaftlichen Metaphern, wobei die Dichotomie von “Erfolg” und “Misserfolg” (in finanzieller Hinsicht) das zentrale Leitbild ist. Die Erforschung von Spielen und Spielsystemen, die nicht “erfolgreich” waren, ist deshalb in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen, weil sie andere Akzente als die bloß ökonomischen aus Spielen herausarbeiten kann; zum anderen, weil sie eine Methoden- und Theoriekritik allzu stark fixierter Forschungsparadigmen der Game (History) Studies zu leisten in der Lage wäre.
Auch wenn die jüngst entstehenden Studienprogramme und Professuren mit ihren entsprechenden Denomination den Eindruck erwecken, “Game Studies” seien ein fest umrissenes Forschungsfeld, mit einem klar abgrenzbaren Gegenstand und einem definierten Methodenset (um nicht -kanon zu sagen), handelt es sich dabei jedoch vielmehr um ein pluriperspektivisches, multimethodisches und vor allem interdisziplinäres Diskursfeld, in welchem Video- und Computerspiele mal im Zentrum des Interesses stehen und mal Anlass zu disziplinenspezifischen Forschungsfragen bilden. Die kulturwissenschaftliche Spieleforschung bildet hierbei den größten Sektor, gefolgt von der medienwissenschaftlichen und musikwissenschaftlichen Untersuchung von Spielen. Neben den synchronen Orientierungen bilden auch diachrone Fragestellungen zur Geschichte (bzw. den Geschichten) der Spiele einen wichtigen Forschungs- und Studienfokus. Die Historiografien zeigen sich jedoch allzu oft von ökonomischen Motiven angetrieben und sind strukturiert von marktwirtschaftlichen Metaphern, wobei die Dichotomie von “Erfolg” und “Misserfolg” (in finanzieller Hinsicht) das zentrale Leitbild ist. Die Erforschung von Spielen und Spielsystemen, die nicht “erfolgreich” waren, ist deshalb in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen, weil sie andere Akzente als die bloß ökonomischen aus Spielen herausarbeiten kann; zum anderen, weil sie eine Methoden- und Theoriekritik allzu stark fixierter Forschungsparadigmen der Game (History) Studies zu leisten in der Lage wäre.
Benjamin Nicolls Buch Minor Platforms in Videogame History versteht sich daher auch weniger als ein Beitrag über Computerspiele als über Computerspielforschung. Auf der Basis von Einzelbetrachtungen zu spezifischen Plattformen nimmt er eine Metapositionierung zu normativen oder gar konservativen Positionen und Methoden der Game Studies ein. Er will zeigen, wie minor platforms Spieleforschern dabei helfen können, solche Positionen zu hinterfragen. Hierzu bedarf es einer guten Kenntnis der Game-Studies-Diskurse und der behandelten Systeme. Obgleich der methodologische Ansatz Nicolls reichhaltig und plausibel ist, zeigen sich jedoch zeitweise Schwächen auf beidem Gebieten. Im Folgenden wird der Band zunächst seinem Aufbau vorgestellt und danach kritisch reflektiert.
Dekonstruktion von Begriffen und Diskursen
Die Einleitung nutzt Nicoll, um seine Begriffe zu definieren, seine Methodologie darzulegen und unterschiedliche Beiträge der Game Studies zur Thematik des Buches kritisch zu reflektieren. Tatsächlich erscheint ihm jeder einzelne Begriff seines Buchtitels erklärungsbedürftig – und dies nicht grundlos, werden Konzepte wie “history” oder “platform” in den Game Studies doch nicht selten als konsensuelle Forschungskonzepte verwendet und unhinterfragt perpetuiert. Gerade aber die minor platforms seien es, die einen kohärenten/kontinuierlichen Begriff von Geschichte unterminieren, stehen sie Nicoll zufolge doch als Elemente von Brüchen jeder erzählten Kontinuität des historischen Diskurses im Wege. Damit sind sie in der Lage als epistemische Dinge zu fungieren, die auf die Selbstverständlichkeit solcher Diskurse aufmerksam machen. Der Begriff “minor” stellt hierbei bereits ein Kriterium kritischer Diskursanalyse dar. Schreibt die zumeist an der Ökonomie interessierte Computerspielgeschichte von “Gewinnern” und “Verlierern” (“failure”) im Sinne wirtschaftlichen Erfolgs, so versucht Nicoll mit “minor” dieses Narrativ zu unterlaufen, indem er den Begriff von Walter Benjamins Passagenwerk (wo dieser bereits den Unterschied zwischen bedeutsamen und unbedeutenden Historemen negiert) oder Deleuze/Guattaris Kafka-Exegese einer “kleinen Literatur” (als geopolitischer und politischer Deterritorialisierung im Prag des frühen 20. Jahrhunderts) als positive Kategorie ableitet: “Minor platforms reveal historical ruptures that deterritorialize videogame history’s well-trodden master narratives.” (S. 19) Seinen “platform”-Begriff entlehnt er den Platform Studies (Bogost/Montfort), die er jedoch dafür kritisiert, dass sie einen zu starken Akzent auf die (Original-)Programmierung der Systeme legt und dabei die Adaption von Softwaretiteln und -katalogen zwischen den Systemen ausblendet. Das Archiv an Computerspielen öffnet Nicoll daher mit den Methoden der Medienarchäologie (insbesondere Siegfried Zielinskis, Jussi Parikkas und Wolfgang Ernsts), ohne dabei die materialistische gegenüber der diskursiven Seite allzu stark betonen zu wollen. Für Letztere stehen vor allem die “feelings” als Untersuchungsgegenstand, die neben den “ruptures” und “epistemic tools” die dritte Achse für Nicolls Analysen bilden: Mit “feeling” ist einerseits die Kopplung zwischen Spieler:innenkörper und Spielsystem (ganz im Sinne von Kybernetik und HCI) gemeint, aber andererseits mehr noch eine Affekt-Ästhetik, welche das Spielen als individuelle und soziale Handlung versteht und für eine Analyse der “alternative structures of feelings” öffne: “[..] the moments of epistemic rupture and transitional instability [...] can be found not only in the technologies themselves. They are also found in the way people imagine, experience, and think with them.” (S. 35) Die Methodik, die Nicoll für die nachfolgende Analyse von fünf “minor platforms” anwendet, ist absichtlich keine einheitliche, sondern akzentuiert für jede der Plattformen eine spezifische Fragestellung.
Die Vectrex als epistemisches Ding
Im Kapitel über die Vectrex-Konsole fokussiert Nicoll aus medienarchäologischer Perspektive vor allem die Technologie(n), die mit dieser Plattform die Privatsphären der Spieler:innen erreicht haben. Das ist zum einen der Vektormonitor, der die Computergrafik nicht wie bei anderen zeitgenössischen Systemen zeilen- und pixelweise generiert, sondern in direkter x-y-Ablenkung des Kathodenstrahls Drahtgittermodelle auf den Bildschirm projiziert. Diese zeichnen sich durch extrem hohe Auflösung sowie Monochromie aus. Die zweite technische Innovation der Vectrex ist ihr rechteckiger Controller, den Nicoll als Vorläufer späterer Eingabesysteme von Konsolen wie Nintendos NES, Segas Master-System oder der Atari 2600 Jr. sieht. Die Auflegefolien schließlich, mit denen die schwarzweiße Grafik der Vectrex eingefärbt wird, sind das dritte “Novum”, welches er diskutiert. Diese drei Technologien seien es vor allem, die den Sonderstatus der Konsole in einer Phase des Umbruchs bestimmen: Die Vektorgrafik öffnet den Spielraum perspektivisch ins (Pseudo-)Dreidimensionalen und entfesselt die Spielelemente, die nun nicht mehr, wie bei der VCS, dem Rasterstrahltiming folgen müssen. Damit führen sie ein Element der Spätsiebziger Arcade-Spiele (Asteroids, Star Wars, Tempest usw.) in die private Spielekultur ein und rufen qua Re-Medialisierung vorherige Technologien, wie Donald Sutherlands “Sketchpad”-Programm oder sogar den frühen RAM-Speicher Williams Tube auf – beides Historeme, die ebenfalls einen Umbruch im Umgang mit Digitalcomputern bedeutet haben. Überdies unterminiert der Einsatz dieser Technologie den tradierten Bewertungsmaßstab der Grafikauflösung und Farbtiefe durch Verwendung einer solchen “unvergleichlichen” Technologie. Der Controller, mit seiner – auch später bei anderen Konsolen anzutreffenden – linksseitigen Steuerung, bildet zusammen mit dem für die Vectrex erhältlichen Light-Pen sowie einem 3D-Headset neue Anschlussstellen für den Körper der Spieler:innen an die Hardware der Plattform. Mit Claus Pias wertet Nicoll dies als Degradierung der Spieler:in zu einem bloßen “third-party observer” (S. 62), dessen Funktion es ist, komplexe Technologien miteinander in den Dialog zu bringen. Die Overlays schließlich gelten Nicoll zufolge als “transitional objects” (S. 63), die nicht nur die Defizienz (dass der Grafik Farbe und Füllung fehlen) betonen, sondern – wie bei der 1972 erschienenen Odyssey-Konsole von Magnavox – auch die Funktion besitzen, Bildinformation zu formatieren (sichtbar machen oder verdecken) und damit die Aufmerksamkeit der Spieler:innen lenken und zu fokussieren. Eben hierin liege auch die Strukturierung des “feelings” durch Suggestion einer stärkeren technischen Standardisierung “of player embodiment and visuality. ”(S. 47)
Piraterie als Dekolonialisierung
War und ist die Vectrex Computerspieler:innen allein aufgrund ihrer markanten Technologie ein durchaus bekanntes System, fällt die Zemmix-Spielkonsole, die Nicoll im zweiten Plattform-Kapitel vorstellt, unter die echten Exoten. Das System wurde nur über einen kurzen Zeitraum in Südkorea angeboten und ermöglichte es den Käufern, Spielmodule, die eigentlich für MSX-Computer-Systeme entwickelt wurden, zu verwenden. MSX war ein von Microsoft und der japanischen ASCII-Corporation 1982 etablierter Hardware-Standard, mit dem auf Heimcomputern unterschiedlicher Hersteller dieselbe Software und Peripherie verwendbar wurde. Dies stellte eine zur Zeit der Homecomputer beachtliche Strategie dar, differierten die 8- und 16-Bit-Systeme doch so maßgeblich voneinander, dass eine regelrechte “babylonische Verwirrung” auf dem Computer-Markt herrschte. Mit MSX gelang es, Computer (einiger unterschiedlicher) japanischer, koreanischer, niederländischer und US-amerikanischer Hersteller zu standardisieren. Die Zemmix-Konsole zehrte von der daraus resultierenden Spiele-Entwicklung, ohne dass ihr Hersteller Daewoo hierzu dem MSX-Lizenzkonsortium beitrat. Das System stellt damit einen Vertreter “illegaler” Spielenutzung dar, begründete dadurch aber den südkoreanischen Spielemarkt, auf dem bald auch eigene Titel für die Konsole entwickelt wurden. Diese lehnten sich allerdings stark an populäre Spiele (zumeist Titel von Nintendo) an, womit noch eine zweite “Piraterie”-Struktur durch die Zemmix-Konsole etabliert wurde. Nicoll wertet diese Entwicklungen als eine Strategie der “Dekolonialisierung”, mit der Südkorea den japanisch und US-amerikanisch dominierten koreanischen Softwaremarkt für Spiele unterminierte. Aus dieser Bewegung ging schließlich eine autarke Computerspielkultur hervor, in der sich Zeitschriften, Homebrew-Spiele und ein Gruppenbewusstsein etablierten. Dabei habe ein “double bind” (S. 85, 88) stattgefunden, indem sich Südkorea gegen die japanische Kulturinvasion wehrte, sie aber zugleich (durch Praktiken der Piraterie) auch absorbierte. Hierin sieht Nicoll Ähnlichkeiten zum Verhältnis Südkoreas gegenüber dem durch den Koreakrieg “eingewanderten” Baseball aus den USA. Im weiteren Verlauf des Kapitels diskutiert er die Software-Eigenentwicklungen für die Zemmix-Konsole, die sich gegenüber ihren ideellen Vorlagen nicht selten wie postmoderne Parodien verhalten. Diese Formen von Piraterie (durch nicht-lizenzierte Hardware und nachprogrammierte Software), welche in Südkorea bis zum Beitritt des CPPA (Computer Programs Protection Act) 1987 stattfanden, werden von Nicoll als kreative Formen der Appropriation kultureller Hegemonialdiskurse (S. 98) gedeutet, die damit eine Form Subversion und ein spezifisches “feeling” von Alterität in die Computerspielgeschichte einziehen.
Auf-/Einbruch ins Private: Neo Geo
Das Heim-Spielkonsolen-Zeitalter, das legt der Name bereits nahe, zeichnet sich durch eine Bewegung der Spieltechnologie aus dem öffentlichen in den privaten Raum aus. Mit dieser Bewegung gingen sowohl technologische als auch ökonomische und ästhetische Veränderungen einher. Zunächst musste die Hardware an die heimische Medien-Infrastruktur angepasst werden (etwa durch TV-Anschlüsse); zugleich musste technisch “abgerüstet” werden, damit die Systeme für Privatanwender erschwinglich wurden. Überdies bedurfte es spezifischer Ästhetiken, die vom “Coin-op”-Prinzip eines schnellen, rundenbasierten, highscorezentrierten Spielens hin zu weitläufigeren Narrationen/Stories, komplexeren Steuerungsmöglichkeiten und über längere Zeiträume hin geplantes Spielen eines Spiels veränderten. Die daraus resultierende Differenz zwischen Arcade- und Heimspiel-Systemen wurde nicht nur positiv gewertet. Nicoll zeigt dies am Beispiel der von SNK 1991 publizierten Neo-Geo-AES-Spielkonsole. Mit dieser wurde nämlich die Strategie verfolgt die “technologische Abrüstung” eben nicht zu vollziehen und anstelle dessen ein System anzubieten, auf dem Spiele des SNK-Arcadeautomaten auch zu Hause spielbar sind. Die Strategie ging nicht auf: Zwar waren Grafik und Sound des 16-Bit-Systems deutlich avancierter als die der zeitgleich existierende Spielkonsolen, jedoch konnte das “Arcade-Feeling” (das soziale Setting, in dem das Spielen stattfand) nicht “privatisiert” werden. Die Spiele für die Neo Geo waren aber genau solche Titel, die vorwiegend für ein Arcade-Publikum entwickelt wurden und sich gerade nicht an den oben genannten neuen Erzähl- und Darstellungsformen orientierten. Die Lücke, die die Neo Geo zu besetzen versuchte, kennzeichnet das System als “imaginary platform” (S. 106), an der sich unerfüllte Erwartungen, kollektive Ängste und unmögliche Träume (ebd.) spiegelten. Diese Imaginationen wurden vor allem durch die Paratexte genährt, die das Erscheinen der SNK begleiteten: das durch die Werbung abgebildete Eindringen der Konsole in die Privatsphäre, die (zeitweise sexistische) Attribuierung mit der “erwachsenen Technologie” oder eine durch die Spielepresse entwickelte irrationale Terminologie wie “Hardcore Gamer” oder “Gameplay” – beide von Nicoll trefflich dekonstruiert. Der hohe Preis der Konsole sowie der Spiele und ihre nicht heim-kompatible Ästhetik führten schließlich zum Misserfolg: “[...] the Neo Geo failed simply because it could not fulfil the impossible dream of a home arcade platform” (S. 118) Heute besitzt die Neo Geo hohen Sammlerwert und hat etliche Retrogaming-Aktivitäten (neue Spiele, Hardwareerweiterungen) provoziert, so dass man von der Konsole – wie auch von allen anderen im Buch erwähnten – nur schwer allein im Tempus des Vergangenen schreiben kann.
Sega Saturn und Sonic X-Treme
Das Retro-Gaming als kulturelle Praxis rückt im nächsten Kapitel über die Saturn-Konsole von Sega (das Nachfolgegerät zum Genesis bzw. hierzulande MegaDrive) noch weiter ins Zentrum. Diese erschien 1994 als Konkurrent zu den 32-Bit-Plattformen von Nintendo und Sony. Nicoll interessiert an dieser Konsole aber weniger deren Geschichte oder Hardware als das Spiel “Sonic X-treme”, das von Sega zunächst für 1996 angekündigt aber schon ein Jahr später, nach einigen Verzögerungen, wieder verworfen wurde. Das Spiel sollte die technischen Möglichkeiten der Saturn weitgehend ausreizen – insbesondere eine “2,5D-Grafik” (das System besaß keine Hardwareunterstützung für 3D-Grafik, daher nutzten viele Spiele eine Mischperspektive). Obwohl es nie eine “fertige” Version von “Sonic X-treme” gegeben hat, entwickelte sich eine lebendige Fan-Kultur um das Spiel, die insbesondere ab den frühen 2000er-Jahren, nachdem die Konsole längst vom Markt verschwunden war, aufblühte: Private Sammler richteten Internet-Archive mit Informationen zum Spiel, Codefragmenten und spielbaren Demos ein. Bald fanden sich Hobbyisten, die “Sonic X-treme” zu Ende programmieren wollten, wobei sehr unterschiedliche Fassungen entstanden. Mit dem stetigen Zuwachs an Informationen und weiteren historischen Sourcecode-Fragmenten eskalierte das “Versions-Chaos” um das Spiel, von dem heute zahlreiche Varianten kursieren – von denen keine jedoch “offiziell” von Sega stammt. Nicoll beleuchtet den medienarchäologischen Zugriff auf Archivalien, den er (zusammen mit Thomas Elsaesser) als “fetischistisch”, weil objektzentriert, attribuiert. Der Versuch der Medienarchäologen, Historiographien und Chronologien durch Unterwanderung von Archiven zu “sprengen”, könne jener “residual mediation” (S. 135), wie sie sich an “Sonic X-treme” zeigt, nicht Herr werden. Die Fan-Kulturen, die unprofessionell und zumeist auf Basis nostalgischer Motive beim Sammeln und Archivieren vorgehen, entwickelten eine spezifische spielerische Ästhetik der “Montage” von Altem mit Neuem (S. 142f.), die ihre Objekte gegen Historisierung sperre. Nicoll wertet diesen antimusealen Umgang mit Computerspiel-Geschichte als eine Verschiebung von den Objekten hin zu den “player experiences, emotions, and feelings” (S. 149), die nicht selten in ein “fixing” von gleichermaßen Technologien (Konsolen, Codes) wie Geschichte kulminieren und ebenso als Lernprozess zu verstehen wären.
Textadventures mit Twine
Das letzte – und umfangreichste – Kapitel widmet sich einer Spiel-Plattform, die sich signifikant von den vorherigen unterscheidet, weil sie zum einen nicht “alt” ist, sondern gegenwärtig noch existiert und genutzt wird, und weil sie zum anderen weder eine Spielhardware noch -software ist, sondern eine Game Engine und damit eigentlich gar kein Spiel, sondern ein Tool, um Spiele zu entwickeln. Die Rede ist von Twine, einem “free open source HTML-based interactive fiction editor” (S. 158), mit dem es möglich ist, interaktive Erzählungen zu komponieren, die im einfachsten Fall Geschichten “hypertextualisieren”, jedoch schon bald nach dem Erscheinen von Twin komplexe und spielbare Text-Adventures hervorgebracht haben. Nicoll interessiert sich für Twine, weil durch das Tool eine Game-Design-Bewegung etabliert wurde, die es nicht nur programmierunerfahrenen Menschen ermöglicht hat, eigene Spielideen umzusetzen, sondern, weil sie vor allem von “minor voices” (S. 158) innerhalb des kreativen und wissenschaftlichen Diskurses Twine genutzt werden. Nicoll zufolge kommen die “twines” (wie die Spiele, die aus der Verwendung von Twine hervorgehen, genannt werden) jenen kleinen Literaturen (Deleuze/Guattari) damit sehr nahe. Insbesondere Narrative mit LGBTIQA+-Topics, Textspiele mit psychologischen, körperpolitischen und sozialutopischen Erzählungen haben Twine eine Sonderstellung innerhalb der Games Community erbracht. Und diese war und ist nicht immer positiv gewertet worden, wie Nicolls Dokumentation der Anfeindungen (die dem Gamergate-Skandal ähneln) zeigt. Mithilfe selbst erstellter Interviews und der Sekundärliteratur versucht Nicoll die Produktion und Rezeption von twines in ein Koordinatensystem von “revolutionary” (S. 161), “independend” (S. 162), “utopian” (S. 169) und cyborgistisch (S. 172, wobei Nicoll hier auf die Verwendungsweise des Begriffs durch Brendan Keogh referenziert) einzuordnen. Die Möglichkeit zahlreiche zum Diskurs der Computerspieltheorie und -geschichte alternative Konzepte an der Plattform zu spiegeln, lässt “Twine” nicht nur zu einem veritablen Beispiel für eine “minor platform” werden, sondern kennzeichnet es zugleich auch als Tool einer “cultural studies of videogames” (S. 180), weil sich durch die Kreation von “unconventional videogames” Theorien zu intellektuellen und politischen Themenfeldern entwickeln und (“spielerisch”) erproben lassen.
Schluss (mit dem Hardwarefetischismus)
Das Buch endet mit einer kurzen Zusammenfassung, die er mit einem Zitat Siegfried Zielinskis überschreib: “something new in the old” (S. 191). Dieser anarchäologische Blickwinkel auf Mediengeschichte soll auch als Leitbild für Nicolls Betrachtung der “minor platforms” gelten. Am Schluss macht er noch einmal deutlich, dass es ihm vor allem um eine Kritik der homogenisierten Game Studies geht, bei der er mit Hilfe minorisierter Spielsysteme auf die notwendige Heterogenität von Spielforschung aufmerksam machen möchte. Dieser Vorsatz ist im Sinne einer Kulturwissenschaft der Computer- und Videospiele gewinnbringend. Ich möchte im Folgenden jedoch auf einige Schwierigkeiten hinweisen, die bei allzu großer Entfernung vom Gegenstand entstehen können.
Nicoll stellt die bislang tradierten ästhetischen, soziologischen, historischen, diskurs- und medienarchäologischen Blickweisen auf Video- und Computerspiele seiner Trias aus “rupture”-, “epistemic tool”- und “feeling”-Analysen anbei und teilweise gegenüber. Während die ersten beiden bereits etwa durch die Medienarchäologie und Platform Studies abgedeckt werden, erscheint die Kategorie des “feelings” als Gegenkonzept zu einer allzu technischen, objektzentrierten Sicht auf das Phänomen Spiele. Der Begriff wird von Nicoll dabei aber in so unterschiedlichen Konnotationen verwendet, dass er stets etwas “schillernd” bleibt. Welche Analysen sich mit Hilfe der “feelings” vornehmen lassen, bleibt vage.
Dieses Problem der “Undeutlichkeit” hat das “feelings”-Konzept einigen anderen von Nicoll verwendeten Begriffen gemeinsam: “resolution”, “cyborg” und nicht zuletzt “videogame” und “platform” werden von Nicoll in alternativen oder ambivalenten Bedeutungen verwendet. Damit werden die technologisch-apriorischen Unterschiede, die etwa zwischen einer Computerspielkonsole und einer Game Engine bestehen, zugunsten einer überordnenden Kategorie (“platform”) ausgeblendet. Diese für einen kulturwissenschaftlich-poststrukturalistische Ansatz zwar fruchtbare Vorgehensweise birgt jedoch auch das Problem einer Verundeutlichung des Forschungsdiskurses, die gerade für eine “floating sub-discipline” (S. 192) wie die Game Studies gleichermaßen symptomatisch und problematisch ist. Hier opfert Nicolls Vorgehensweise die interdisziplinäre Zugänglichkeit einer kreativen Intellektualität. Dies lässt sich an seinem Begriff der Medienarchäologie besonders deutlich zeigen.
Medien(an)archäologie(n)
Medienarchäologie wird von ihm verstanden als eine Art von technikzentrierter (oder gar “fetischistischer” [vgl. S. 141f.]) Diskursarchäologie. Die Archive, in denen die technischen Artefakte/Monumente gespeichert werden, seinen jene Orte, an denen Erkenntnisse von Medienarchäologen “ausgegraben” (vgl. Ss. 133, 139, 157) werden. Die Apparate selbst als ungeschichtliche Archive zu verstehen, die sich allein aufgrund ihrer Operativität jeder Historiografie entziehen, wie es im Sinne des von Nicoll zitierten Medienarchäologen Wolfgang Ernsts wäre, unterlässt er. Sein Begriff von Medienarchäologie wäre damit eher in die kulturwissenschaftliche Forschungstradition im Sinne Pias, Huhtamos, Parikkas oder Elsaessers einzuordnen. Von dieser Warte aus wird auch verständlich, warum Nicoll die Praktiken des Retrocomputings (etwa beim Re-enactment des “Sonic X-treme”-Spiels) als Kontrastprojekte zur medienarchäologischen “Fetischisierung” von Geschichte darstellt – obwohl sie im Sinne jener “Berliner Schule” genau das sind, was Medienarchäologie ist: redaktionelles Eingreifen (so Dionysius von Halikarnaß Begriff der archaiologia - kontrastierend zu Nicolls etymologischem Vorschlag “governance, ruling, and origin” [S. 198]) in scheinbar historische Prozesse – und nicht etwa die “Ausgrabung” historiographisch verfemten Wissens. Dieser Eingriff muss stets auf den untersten Ebenen der Plattformen stattfinden. Ob das Game-Design mit Hilfe von Tools wie Twine tatsächlich “demokratisiert” (S. 165) wird, muss damit kritisch hinterfragt werden: Twine bleibt, wie alle Game Engines, eine Software-Blackbox, die den Spieler:innen/Spieldesigner:innen nur so viel Kreativität zumisst, wie die Programmierer es zu(ge)lassen (haben). Nicolls Kontrastierung der Cyborgs mit den (negativ konnotierten) Hackern (S. 171f.) verliert vor diesem Hintergrund ihr epistemologisches Potenzial: Wie können Autonomie und Revolution (im Game-Design) auf der Basis von technischer Fremdbestimmung gedeihen?
A closer look
Bei aller Disziplinenkritik darf, zumal wenn dabei der disziplinäre Blick auf das Phänomen kritisiert wird, dieses Phänomen nicht weniger genau betrachtet werden. Zeitweise sind Nicolls Ausführungen zu Computerspielhard- und -software jedoch technisch unpräzise, etwa, wenn er behauptet, der Monitor der Vectrex wäre in der Lage Ort und Größe von Objekten zu berechnen (“calculate”, S. 51). Vielmehr ist es die CPU (Motorolas 6809) und der DVG (Digital Vector Generator), die dies leisten. Dies zu erwähnen, ist durchaus keine Spitzfindigkeit, bieten beide Bauteile doch erstmals die Möglichkeit, schnelle Multiplikation und Division (CPU) zusammen mit implementierter Vektormathematik (DVG) zu kombinieren. Sowohl die technischen als auch die mathematischen Paradigmen dieser Technologie unerwähnt zu lassen, schwächt die epistemologische Überzeugungskraft der Analyse, weil dies ebenso Elemente der “rupture” darstellen.
Ein anderes “minority”-Argument wird dafür meines Erachtens zu Unrecht stark gemacht: Im Zemmix-Kapitel versäumt es Nicoll, die sehr rege (und durchaus legale!) Beteiligung koreanischer Unternehmen (Samsung, Goldstar, Daewoo) am MSX-Computermarkt zu erwähnen. Das, was er über die Zemmix-Konsole und die damit verbundenen Praktiken schreibt, mutet ohne diesen Hinweis wie Piraten-Romantik an. Seine Argumentation von “Cloning” der NES-Spiele für die Zemmix bedürfte überdies einer technisch präziseren (vergleichenden) Beschreibung von Original und Clone (die dann allerdings wiederum auf der Codeebene stattfinden müsste). Denn der Rechtsgeschichte der Computerspiele hat die Ähnlichkeit von Oberflächen allein nicht immer als Ausweis von Verwandtschaft genügt, wenn sich die “Unterflächen” (Frieder Nake) zu stark voneinander unterschieden haben. Das hat der Urheberrechtsstreit zwischen Atari und Magnavox (bei dem es um die Frage ging, “Pong” ein Clone der “Odyssey” sei) gezeigt. Die Unterschiede einer Z80-Prozessor-Architektur wie bei MSX und Zemmix im Gegensatz zur 6502-Architektur der Nintendo NES könnten würden ein ähnliches Resultat ergeben, so deutlich unterschieden sich die beiden 8-Bit-Prozessoren und ihre Peripheriebausteine voneinander.
Im Schlusskapitel merkt Nicoll selbstkritisch an, dass seine binäre “major-minor”-Opposition wohl zu Recht nicht gerade queere Kritik an historiografischen Narrationsmustern darstellt. Ebenso kann er aber auch zeitweise der Verknüpfung von Historemen durch Kausalitätsbehauptungen nicht entziehen – etwa, wenn er den Vektormonitor der Vectrex als durch das Display von “Tennis for Two” beeinflusst beschreibt. (S. 50) Nicht nur steht dieses Display als Oszilloskop angeschlossen an einen Analogcomputer, für eine völlig andere Episteme; auch kannte 1981, als die Vectrex entwickelt wurde, kaum noch jemand “Tennis for Two”, welches erst 1983 im Rahmen des oben genannten Gerichtsverfahrens zwischen Atari und Magnavox wiederentdeckt wurde. Diese zugegebenermaßen sehr detailfixierten Kritikpunkte schwächen den Diskurs der Computerspielgeschichtskritik von Nicolls Buch und vor allem seine Intention einer Kritik der Disziplin nicht maßgeblich. Sie fallen jedoch denjenigen, die mit den Spielen selbst und ihren technischen Apparaturen befasst sind, auf – diejenigen mögen die Zeichnung der Vectrex auf dem Buchcover, bei der der Modulslot auf der falschen Seite ist, bereits als dezenten Hinweis verstehen.
