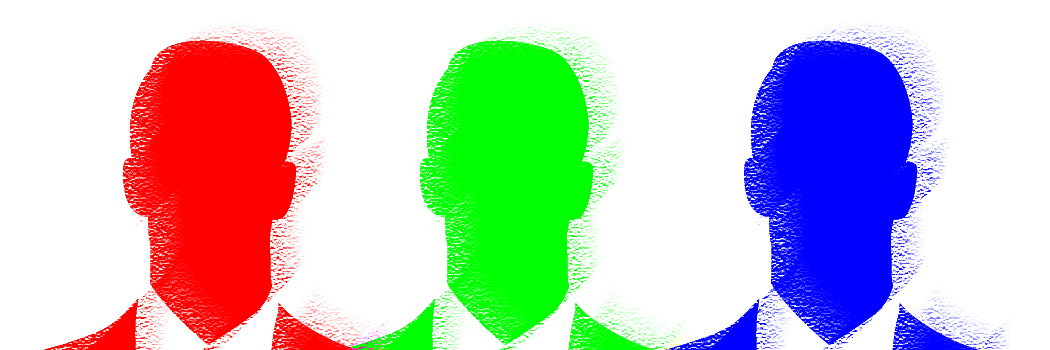
Das dreifache Immersionssubjekt – Subjektspaltung und -konstruktion im Computerspiel
Computerspiele sind anders als andere Medien. Nicht nur, weil sie grafische, musikalische und narrative Elemente zu einem medialen Konglomerat vermischen, was beispielsweise der Film, das Theater oder die Oper auch tun, sondern auch – und insbesondere –, weil sie das den traditionellen Medien eigene Konzept des Medienrezipienten gänzlich neu definieren. Die Spielenden sind nicht mehr, wie bei Malerei, Film oder Literatur, bloß aufnehmend oder betrachtend, sie partizipieren vielmehr an der Entstehung des eigentlichen Narrativs. Ihre Fähigkeit geht gar über die reine Interaktion hinaus, sie „liegt in der Manipulationsmöglichkeit des interaktiven Bildes selbst“. 1 Dieser eigentümliche und durchaus auch neuartige Status des spielenden Subjekts verlangt nach einer näheren Untersuchung desselben. Nicht zuletzt, um etwaige narrative Potentiale, die sich aus den Charakteristika dieses neuen, aber bereits wenige Jahrzehnte nach dessen bescheidenen Anfängen sehr populären Mediums ergeben, aufzuzeigen.
Doch wie lässt sich ein Subjekt verstehen, das mit einem Medium nicht nur rezipierend, sondern de facto konstruktiv interagiert? Einen Definitionsversuch wagt Günzel, indem er das Subjekt mit den cartesianischen Kategorien res extensa und res cogitans zu begreifen sucht. 2 Analog zu Descartes, bei welchem res extensa den rein materiellen, vom Geist getrennten Körper, und res extensa im Gegenzug die rein geistige, mentale Substanz, die streng vom Körperlichen getrennt wird, bedeutet, lässt sich ersteres in diesem Kontext als das vom eigentlichen Spiel exkludierte, körperliche Subjekt verstehen, letzteres das Subjekt als spielende, d.i. sich geistig im Spiel befindende Entität.
Wenngleich es zweifellos nachvollziehbar und gerechtfertigt ist, das spielende Subjekt als ein mehrfaches zu verstehen und die Trennung zwischen innerhalb und ausserhalb des Mediums zu betonen, so wird die cartesianische Dichotomie der Komplexität des Gegenstandes bzw. der Situation, in welcher sich ein spielendes Subjekt befindet, bestenfalls teilweise gerecht. Günzel selbst wagt in der Folge eine weitere Annäherung. Ähnlich zu Taylors Untersuchung der „relationship of the player, player-character and the screen“ 3 unterteilt er das Subjekt in drei Teile, basierend auf den Husserl’schen Kategorien des Bildobjekts, Bildträgers und Bildsujets. 4 Diese Einteilung ist freilich auf den visuellen Aspekt der Darstellung beschränkt und lässt die Audio-Elemente außen vor; für die hier relevante Untersuchung ist diese Unterlassung, wie sich später zeigen wird, jedoch nicht relevant. Der Bildträger bezeichnet das von seiner Umwelt klar abgegrenzte Material bzw. den Gegenstand, auf dem sich das Bild befindet, im Computerspiel-Kontext den Monitor- oder Fernsehbildschirm bzw. die gegenwärtig vermehrt in Erscheinung tretende Virtual-Reality-Brille. Das Bildobjekt beschreibt die Tatsache, dass etwas abgebildet ist, d.i. dass das, was auf dem Bildträger zu sehen ist, einerseits nicht das reale Objekt, andererseits eine Darstellung ist, wobei die Betrachtenden sowohl das Abgebildete wie die Abbildung – hier: die dargestellte Spielwelt wie auch die Pixel, aus denen sich der Bildschirm zusammensetzt – in ihren Fokus nehmen können. Das Bildsujet schließlich bezieht sich auf das, was konkret dargestellt wird, also die realen oder imaginierten Objekte, auf welche die Darstellung verweist. 5 Das Subjekt interagiert zeitgleich mit dem Bild qua sichtbarem Bildobjekt, dem materiellen Bild qua Bildträger und dem dargestellten Thema, d.i. dem Bildsujet. Diese Dreiteilung erscheint exhaustiver als die zuvor dargestellte cartesianische Dichotomie und soll im Folgenden als Ausgangspunkt für die hier vorgeschlagene Definition des mit Computerspielen interagierenden Subjekts dienen.
Grundsätzliche Eigenschaften des Subjekts
Um über das Subjekt als solches nachdenken zu können, lohnt sich zunächst der Versuch, fundamentale Charakteristika desselben genauer zu erfassen. Hierfür hat die Analyse traditioneller Medien, insbesondere in der Literaturwissenschaft, bereits Vorarbeit geleistet. Nicht zuletzt seit Paul Ricoeurs theoretischen Überlegungen in Zeit und Erzählung 6 wird davon ausgegangen, dass ein Subjekt als nichts in sich Abgeschlossenes, sondern vielmehr als etwas ständig im Wandel Seiendes gedacht werden muss. Es gestaltet sich als eine Ansammlung von Geschichten, welche die Charakteristik des Subjekts kontinuierlich modifizieren, woraus – paradoxerweise – eine für das Subjektsein notwendige Kohärenz der Entität entsteht.
Für die weiteren Überlegungen soll dieser Ansatz des kontinuierlichen Wandels als notwenige Kohärenz im Zentrum des Interesses stehen. Die philosophische Diskussion darum, was ein Subjekt ist, ist freilich unüberblickbar. Interessant an Ricoeurs Ansatz, insbesondere für den vorliegenden Kontext, ist jedoch einerseits, dass er das Subjekt explizit mit medialer Rezeption in Verbindung bringt, andererseits, dass die Theorie nicht auf bestimmte ein Subjekt modifizierende Charakteristika fokussiert, sondern sich darauf beschränkt, was ein Subjekt als solches ausmacht, also quasi die Minimalanforderungen an ein Subjekt zu erfassen versucht. Dennoch wären andere Ansätze denkbar, müssen jedoch anderen Arbeiten vorbehalten bleiben.
Da bei der Rezeption von Medien immer mindestens zwei potentielle Subjekte relevant sind (namentlich das rezipierende einerseits sowie das im Medium existierende andererseits), führt Ricoeurs Theorie jedoch zu zwei besonders wichtigen Erkenntnissen: Erstens besteht bei der Rezeption traditioneller Medien, wie beispielsweise der Literatur, eine klare Trennung zwischen diesen beiden Subjekten, d.i. dem lesenden Subjekt und demjenigen, das innerhalb der Diegese, also ‚im Buch selbst‘ agiert. Allen etwaigen Identifikationsversuchen seitens der Lesenden zum Trotz bleibt zwischen ihnen eine unüberwindliche Barriere bestehen. Es müsste folglich beiden Subjekten, möchte man ihnen den Status eines Subjekts zugestehen, die Eigenschaft zukommen, etwas im Werden befindliches, nichts Abgeschlossenes zu sein.
Zweitens – und damit zusammenhängend – ist die Tatsache zu sehen, dass das lesende Subjekt tatsächlich als solches gedacht werden kann. Das lebensweltliche Subjekt wird aus dem Input, den es aus literarischen (und anderen) Geschichten erhält, konstituiert; diese bilden einen Teil der Gesamtheit der eigenen Geschichten, welche das Subjekt als solches ausmachen. 7
Ob dies allerdings auch für das dargestellte Subjekt gilt, ist fraglich. Es ließe sich namentlich einwenden, dass das dargestellte Subjekt, eben aufgrund der Tatsache, dass es ein dargestelltes ist, kein eigentliches Subjekt sein bzw. werden kann. Dies ist zweifellos richtig; die Gründe dafür werden in der Analyse weiter unten beschrieben. Nichtsdestotrotz ist anzumerken, dass, sofern an Ricoeurs Definition festgehalten wird, bei beiden Subjekten, dem dargestellten und dem rezipierenden, ein ‚Subjektideal‘, also der oben beschriebene kontinuierliche Wandel, präsupponiert werden kann. Ob das konkrete potentielle Subjekt diesem Ideal gerecht werden kann, steht auf einem anderen Blatt.
Das Immersionssubjekt
Es ist angesichts der vorausgegangenen Überlegungen unschwer nachzuvollziehen, dass ein mit Computerspielen interagierendes Subjekt gänzlich anders funktioniert. Dies in erster Linie schlicht aufgrund der Tatsache, dass die Grenze zwischen dem lebensweltlichen und dem fiktionalen Subjekt so nicht mehr postuliert werden kann. Die Barrieren zwischen den beiden Entitäten verschwimmen oder – wie sich weiter unten herausstellen wird – verschwinden gar, was eine andere Herangehensweise an das Verständnis des Subjekts notwendig macht.
Das in der Folge dargestellte Modell des spielenden Subjekts orientiert sich, wie weiter oben dargelegt, an den Ausführungen Günzels in Anlehnung an Husserl, weicht jedoch in einigen Details davon ab. Da beim Computerspiel die erwähnten Grenzen zwischen Subjekten verschwimmen und häufig seitens des Spiels der Anspruch besteht, darüber hinaus die Grenzen zwischen spielendem Subjekt und dem Medium an sich verschwimmen zu lassen, um sog. Immersion herzustellen, erscheint die Bezeichnung Immersionssubjekt angemessen.
Das Immersionssubjekt wird im Folgenden genauer definiert. Es basiert auf der Dreiteilung von Günzel, allerdings modifiziert es diese leicht zu Medium – dargestellte Welt – gespielte Figur, was sich nicht gänzlich mit der Einteilung von Husserl, die allerdings als Grundidee von großer Wichtigkeit bleibt, deckt. Darüber hinaus orientiert sich die Definition an der Bemerkung von Taylor, dass das spielende Subjekt in erster Linie eine räumliche Teilung erfährt, denn „the player operates both on the game space and within the game space“. 8
- Interaktion mit dem Medium als solchem: Das Immersionssubjekt ist nicht zuletzt – wenn nicht gar zuallererst – eine Person, die mittels einer Steuereinheit (Controller, Tastatur, Maus etc.) mit dem Medium Computerspiel interagiert. Sie befindet sich physisch in der eigentlichen Lebenswelt und ist sich der Interaktion mit dem Medium, außer in einem fraglich realistischen Zustand totaler Immersion, wie sie Virtual-Reality-Geräte wie Oculus Rift – gegenwärtig freilich noch nicht allzu ausgereift – zu vermitteln suchen, bewusst.
- Interaktion mit dem Medium innerhalb der dargestellten Welt: Das Immersionssubjekt ist nicht nur in der Lage, den jeweils dargestellten Ausschnitt der Spielwelt zu betrachten, sondern vermag auch etwaige mögliche Lokalitäten bzw. Ereignisse zu antizipieren. Es ist sich entsprechend, um nochmals auf Günzels Terminologie zurückzugreifen, der Virtualität der Simulation bewusst, d.h. der potentiellen Darstellungen jenseits der gegenwärtigen, verwirklichten Darstellung. 9 Überspitzt gesagt weiß das Subjekt, dass das Computerspielbild nicht an den Grenzen des Monitors oder Fernsehers aufhört, sondern darüber hinaus ‚weitergeht‘. Es kann, abhängig vom gegenwärtigen Geschehen auf dem Bildschirm, zumindest partiell auf den – aus der Filmwissenschaft bekannten – offscreen space 10 schließen, unabhängig davon, ob es diesen bereits erfahren hat oder nicht.
Es ist ergänzend zu erwähnen, dass sich Virtualität in diesem Kontext nicht nur auf spatiale Virtualität, also die Menge der in der Spielwelt zu erwartenden Räume, beschränkt, sondern vielmehr auch eine narrative Virtualität umfasst. Ebenso wie das Immersionssubjekt bestimmte Lokalitäten in der Spielwert antizipieren kann, verfügt es über die Möglichkeit, narrative Elemente oder Strukturen vorauszuahnen. Dies trifft zwar auch auf andere narrative Medien zu, allerdings ist die Möglichkeit der Realisation von Virtualität beim Computerspiel in den Händen der Spielenden; sie können selbst entscheiden, welchen Teil der Virtualität sie erforschen möchten. - Interaktion mit dem Medium als fiktionale (gespielte) Figur: Das Immersionssubjekt ist zuletzt auch gleichzusetzen mit der gespielten Figur. Diese ist durchaus als eigentliche Gleichsetzung zu verstehen; anders als bei der Identifikation mit Protagonisten herkömmlicher Medien besteht zwischen dem Subjekt und der gespielten Figur eine besondere Bindung. Wenngleich auch bei Film oder Literatur behauptet werden kann und wird, man könne sich mit einer Figur identifizieren, so stößt diese Identifikation zwangsläufig an ihre Grenzen, wenn die Innerhalb-Ausserhalb-Dichotomie bzw. die Trennung zwischen lesendem und fiktivem Subjekt ins Bewusstsein tritt. So ist bei der Lektüre eines Romans nicht möglich zu sagen, der Protagonist (oder eine beliebige andere Figur) sei ich. Es ist darüber hinaus einem Dritten nicht möglich, den Lesenden nahezulegen, sie sollen sich innerhalb der Roman-Diegese in diese oder jene Richtung bewegen o.ä.
Dies und mehr ist allerdings beim Computerspiel völlig selbstverständlich, was darauf schließen lässt, dass das Subjekt eine Figur – die übrigens nicht unbedingt eine humanoide Figur sein muss, sondern durchaus auch etwas Abstraktes wie z.B. eine Kameraperspektive sein kann – nicht nur spielt, sondern tatsächlich ist. 11 Andere Interaktionen mit Medien bieten zwar ähnliche Identifikationsmöglichkeiten; insbesondere diejenigen, bei denen man ebenso ‚spielt‘, beispielsweise als Protagonist in Pen-And-Paper- bzw. Tabletop-Rollenspielen oder als Schauspieler im Theater. Erstere sind jedoch nichts Anderes als teilweise visuell unterstützte Hilfsmittel für eine Geschichte, die in erster Linie im eigenen Kopf stattfindet. Schauspieler wiederum entbehren einer gewissen gestalterischen Freiheit, da sie, überspitzt gesagt, im Grunde genommen Befehle ausführen. Sie kommen jedoch einem Immersionssubjekt dennoch am nächsten, weil sie innerhalb des Spiels zumindest partiell eine Produzentenrolle einnehmen (vgl. weiter unten).
Der Umstand, dass das Immersionssubjekt zeitgleich auf dreierlei Arten mit dem Medium interagiert, stellt vermutlich das Alleinstellungsmerkmal des Mediums Computerspiel dar. Es gilt jedoch zu beachten, dass sich erst dann, wenn alle drei Interaktionsarten seitens des Immersionssubjekts realisiert werden, das einstellt, was gemeinhin als Immersion bezeichnet werden kann. Deutlich lässt sich dies anhand von Gegenbeispielen aufzeigen, d.i. anhand von Situationen, welche eine der drei Ebenen stören und einen Immersionsbruch nach sich ziehen. So kann die Immersion gebrochen werden, wenn während des Spiels das (lebensweltliche) Handy klingelt oder die Nudelsuppe überkocht. Darüber hinaus, wenn die angenommenen Regeln der Virtualität durchbrochen werden bzw. inkonsistent sind, so beispielsweise wenn die Spielenden an einer ‚invisible wall‘ hängenbleiben oder das Charaktermodell Darstellungsfehler wie sich überschneidende grafische Assets aufweist. Schliesslich liegt Immersionsstörung vor, wenn sich die Spielenden nicht mit der gespielten Figur identifizieren können, sei es, weil ihre Handlungen nicht nachvollziehbar oder ihr Charakter nicht ansprechend ist. Dies bedeutet, dass die Handlungen bzw. der Charakter der Figur, wenn nicht realistisch, so doch mit sich selbst und dem Setting konsistent sein müssen. So wäre es beispielsweise immersionsstörend, wenn ein First-Person-Shooter-Kämpfer auf dem Schlachtfeld plötzlich anfinge, Lambada zu tanzen.
Interessanterweise wird gerade dieser Immersionsbruch in einigen modernen Shootern explizit zugelassen, indem die Figur auf Knopfdruck Tanzbewegungen ausführen kann. Es ließe sich folglich einwenden, dass einzelne Entwickler die Immersion absichtlich stören, um bestimmte Meta-Überlegungen bei Spielenden auszulösen, d.h. das Medium Computerspiel als Medium explizit darzustellen. Dies ist durchaus möglich und wird auch praktiziert; interessante aktuelle Beispiele hierfür sind UNDERTALE, 12 Pony Island 13 oder SUPERHOT. 14 So wirft UNDERTALE in bestimmten Situationen die Spielenden abrupt zurück auf ihren Desktop und spricht darüber, seinen Speicherplatz zu löschen – was es dann auch tut; die Datei ist später nicht mehr auf dem Rechner auffindbar. Pony Island stilisiert das Spiel als Spiel im Spiel und thematisiert eine schlechte Programmierung desselben, und SUPERHOT schränkt teilweise gewollt die Steuerungsmöglichkeiten der Spielenden ein und kehrt damit die Interaktivität um – plötzlich steuert das Spiel die Spielenden und nicht umgekehrt. Dennoch wird der Immersionsbruch in solchen Fällen durchaus als solcher empfunden, die Störung ist also, obgleich beabsichtigt, zweifellos präsent.
Narratologische Konsequenzen des Immersionssubjekts
Es scheint nachvollziehbar, dass unter den beschriebenen Umständen nicht nur die Charakteristik des Immersionssubjekts selbst, sondern vielmehr die Möglichkeiten der Narration im Medium Computerspiel neu gedacht werden müssen. Dass ein Transfer eines Spiels, insbesondere eines Open-World-Titels, in eine Erzählung zwangsläufig mangelhaft bleiben muss, zeigt Schuppisser mit der Nacherzählung einer Quest aus Red Dead Redemption 15 überdeutlich auf. 16 Mukherjee bestätigt, dass Computerspiele, gerade weil sie von einem interagierenden Immersionssubjekt gespielt werden, narrative Strukturen entwickeln, die mit den Mitteln literarischer Erzähltheorie, beispielsweise derjenigen von Genette, nicht erfasst werden können. 17 Als Beispiel nennt er zeitliche Strukturen, die keinen gängigen Schemata folgen. Die Tatsache, dass die Möglichkeit von Checkpoints oder manuellem Speichern existiert, führt so zu einer prinzipiellen Pluralität von Ereignissen, die zwar (aus externer Sicht) nacheinander gespielt werden, zugleich aber (aus spielinterner Sicht) logisch gleichzeitig existieren. So werden Statements möglich wie „I kept dying every time I went past that door“, 18 die von Rezipierenden anderer Medien nicht sinnvoll geäußert werden können.
Während literarische Werke also zwar auch u.a. mit Iteration und Varianten operieren, sind Computerspiele genuin anders:
[T]hey are simultaneously all of these things [d.h. alle möglichen Varianten desselben Geschehens; BP] at once in any instance or series of instances of gameplay. The moment one presses the reload button in the game, an already complex multiplicity of events is further complicated by associations of more events, which are repetitions and yet different […]. To come anywhere near plotting such a structure, one would have to include all the events, running back and forth and literally along the timeline – an almost impossible task. 19
Titel wie Braid 20 oder Super Time Force Ultra 21 erheben diese neuartigen Eigenschaften gar zu Grundprinzipien ihrer Spielmechanik, was hochkomplexe und bisweilen verwirrende temporale Strukturen zur Folge hat.
Dies zeigt den narratologischen Unterschied zwischen nicht-interaktiven und interaktiven Medien deutlich auf. Während erstere ihre Geschichte auf lineare Art erzählen, ist das Computerspiel als interaktives Medium genuin non-linear. Oder, um Roman Jakobsons kanonische Terminologie zu verwenden: 22 Eine beispielsweise literarische Geschichte wurde während ihres Entstehungsprozesses von einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller aus einer Unzahl möglicher Darstellungsarten – Paradigmen – in eine fixe lineare Abfolge – ein Syntagma – gebracht. Einmal in dieser Form, ist es Dritten lediglich möglich, das Syntagma zu rezipieren und bestenfalls über die zu Grunde liegenden Paradigmen nachzusinnen. Computerspiele treten demgegenüber gewissermassen einen Schritt zurück; sie bieten den Spielenden zwar keine unendlichen, aber doch modifizierbare Paradigmen, die sie selbstständig zu einem Syntagma formen dürfen und sollen. Immersionssubjekte sind demzufolge nicht nur Rezipienten, sondern auch Autoren gespielter Werke.
Dies bedeutet freilich nicht, dass die Möglichkeiten der Spielenden unbegrenzt sind. Schliesslich bildet das Spiel ein ‚Framework‘, das die Anzahl möglicher Interaktionen einschränkt. Dennoch ist es auffällig, dass gerade in letzter Zeit das Interesse am Paradigma und den Möglichkeiten desselben merklich zugenommen hat. So versuchen Open-World-Titel oder Sandbox-Spiele, die sich permanent erweitern, die Freiheit der Spielenden so groß wie möglich zu gestalten, indem sie außerordentlich viele Möglichkeiten der Syntagma-Erstellung zur Verfügung stellen und hierfür oftmals lineare Narration vernachlässigen. Es wird den Spielenden überlassen, ob sie die eigentliche, lineare Story auch tatsächlich als eine solche spielen möchten. Andere Titel wiederum, die sich ebenso großer Popularität erfreuen, versuchen, noch einen Schritt weiter zurückzutreten und nicht nur das Syntagma, sondern gar die Paradigmen, also die Bausteine der Spielwelt, den Usern zwecks Manipulation zur Verfügung zu stellen – das berühmteste Beispiel hierfür dürfte wohl Minecraft sein. 23 Diese Situation ist dezidiert anders als bei herkömmlichen Aufbauspielen bzw. Wirtschaftssimulationen im Stil von SimCity; 24 während es in diesen Titeln zwar möglich ist, bestimmte vorgefertigte Elemente, beispielsweise Gebäude, an einem frei gewählten Ort zu positionieren, haben die Spielenden nicht die Möglichkeit, nicht-vorgefertigte Phantasiegebilde zu errichten. Am ehesten ließe sich der Unterschied zwischen den beiden Genres mit demjenigen zwischen Spielsoldaten und Lego illustrieren. Spielsoldaten kann man irgendwohin setzen und mit ihnen imaginierte Szenarien spielen, jedoch ist es, anders als bei Lego, kaum möglich, ihnen die einzelnen Gliedmasse auszureißen und daraus ein neuartiges Monstrum zu erschaffen, ohne das Spielzeug selbst zu zerstören.
Im vorliegenden Kontext von besonderer Wichtigkeit jedoch ist eine andere Art der Herangehensweise. Gewisse Titel machen ihre (vermeintliche) Linearität bzw. Syntagmatik sowie die Erwartungen der Spielenden an die Virtualität explizit zum Thema, fordern selbige heraus und transzendieren damit Grenzen, an welche die Literatur bereits vor einigen Jahrzehnten gestoßen ist. Im Folgenden wird The Stanley Parable 25 ein Titel, der sowohl die Erwartung von Linearität als auch diejenige von Nicht-Linearität zum Gegenstand macht, als eine Fortsetzung genuin literarisch-poetologischer Reflexionen, die sich im Werk Max Frischs finden, zu interpretieren versucht.
The Stanley Parable als Weiterführung literarisch-poetologischer Experimente
Um aufzuzeigen, dass das Computerspiel nicht nur genuin neuartige Narrative bildet, sondern auch – allen etwaigen eigenen Grenzen zum Trotz – die Grenzen traditioneller Medien transzendiert und somit als deren Weiterentwicklung verstanden werden kann, lohnt es sich insbesondere, auf Werke zu fokussieren, die sich bereits an die Schranken des medial Darstellbaren wagen. So untersucht beispielsweise Mukherjee, wie oben erwähnt, die Möglichkeiten temporaler Darstellung im Computerspiel im Vergleich zu literarischen Werken, die experimentell mit dem Thema der Zeitlichkeit umgehen. 26
Analog hierzu soll im Folgenden ein Text als Beispiel dienen, der sich explizit mit dem Thema des Subjekt-Seins, des kontinuierlichen Werdens und der Endgültigkeit geschriebener Texte auseinandersetzt. Max Frischs experimenteller Roman Mein Name sei Gantenbein aus dem Jahr 1964 ist ein ungewöhnlicher Text. Er verzichtet auf eine Protagonistin oder einen Protagonisten und ersetzt diese durch eine Leerstelle, die sich selbst im Laufe des Textes mittels Geschichten in eine konturierte Figur zu transformieren versucht. 27 Daher verzichtet der Roman auch auf eine stringente Erzählung – Fragmente von Geschichten reihen sich aneinander, wiederholen sich mit leichten bis gravierenden Änderungen und sogar der Protagonist selbst ist nicht immer dieselbe Figur. Die Abneigung gegen alles Fixierte und Vollendete, die sich in Frischs Texten immer wieder beobachten lässt, 28 findet hier ihren literarischen Höhepunkt.
Die Erzählinstanz des Romans, die von Frisch selbst als „weißer Fleck“ bezeichnet wird, 29 hat entsprechend den Anspruch, ein Subjekt in Ricoeurs Sinn, d.h. eine sich kontinuierlich wandelnde und eben deshalb in sich konsistente Entität zu sein. Sie möchte entsprechend in einer kontinuierlichen Veränderung existieren bzw. sich mittels Geschichten ständig neu bilden. Die Erzählinstanz wehrt sich im Laufe des Romans konsequenterweise gegen jegliche Arten von Fixierung bzw. Syntagmatisierung, also im Grunde gegen ein Festgeschrieben-Werden. Die tragische Paradoxie hiervon ist jedoch, dass die Erzählinstanz dies versucht, während sie bereits die ganze Zeit über qua Text festgeschrieben ist. Es ist ihr demzufolge nicht möglich, ihr Ziel zu erreichen, da sie gar nie die Möglichkeit hat, mit einem Paradigma zu operieren und sich selbst kraft ihres Willens zu verändern. Die Tatsache, dass sie nur als fiktive Figur in einem Text existiert, verunmöglicht es ihr, das Syntagma, das sie umgibt (bzw. welches sie materialiter selbst ist), zu transzendieren.
Konsequenterweise endet der Roman mit einer Szene, in der sich die Erzählinstanz, soweit möglich, mit dieser Art der Existenz versöhnt. An einem Septembertag in Italien trinkt sie Weißwein und wartet auf Fisch, der geröstet wird, und äußert die zugleich sehnsüchtige und resignierende Bemerkung „Durst, dann Hunger, Leben gefällt mir –“, 30 wobei der Gedankenstrich den Wunsch nach einer Fortsetzung des Werdens, nach einem Leben im Potentialis verstärkt, während der Text selbst zugleich erbarmungslos endet.
Offensichtlich ist, dass sich diese Paradoxie in einem traditionell-linearen, also syntagmatischen, Medium nicht auflösen lässt. Es bildet eine Grenze, an deren Transzendenz das Medium selbst – in vorliegendem Fall die Literatur – zwangsläufig scheitern muss. Es ließe sich höchstens behaupten, dass der Versuch der Erzählinstanz, ein Subjekt zu werden, im Moment der Produktion des Textes stattfindet, während des Aufbaus des Syntagmas aus dem Paradigma. Jedoch ist hierbei zu bedenken, dass in dieser Situation, wie weiter oben erläutert, eine nicht aufhebbare Dichotomie zwischen der schreibenden Entität und der fiktiven Erzählinstanz besteht. Entsprechend ist die Erzählinstanz immer auch erzählte Instanz, und somit dem bzw. der Schreibenden subordiniert.
Beide Phänomene ergeben sich beim Medium Computerspiel nicht; weder ist das Festgeschrieben-Sein der erzählten Instanz gegeben, da der Vorgang des Spiels in ebendieser genuin variablen Festschreibung besteht, noch ist eine eigentliche Trennung zwischen gespielter Figur und dem spielenden Subjekt möglich. Beide bilden das Immersionssubjekt bzw. Teile davon, und sind zugleich dasselbe und nicht dasselbe. Die Möglichkeiten, die sich aus dieser medial wohl einzigartigen Konstellation ergeben, werden im Spiel The Stanley Parable meisterhaft inszeniert.
The Stanley Parable ist ein First-Person-Spiel mit denkbar einfachem Plot. Der Angestellte Stanley, der sein gesamtes (Arbeits-)Leben lang nichts Anderes tut, als auf einem Computer diejenigen Knöpfe zu drücken, die ihm der Computer zu drücken befiehlt, erhebt sich eines Tages von seinem Arbeitsstuhl, tritt in den Gang hinaus und merkt, dass seine Arbeitskollegen verschwunden sind. Das gesamte Gebäude ist menschenleer und entsprechend ist die Interaktionsmöglichkeit mit der Welt sehr eingeschränkt. Es gibt keine Gegner, keine Schießmechaniken oder dergleichen; Stanley kann nur gehen oder mit einfachen Gegenständen (beispielsweise einer Tür) interagieren. Die einzige Stimme, die Stanley bzw. der/die SpielerIn hört (es bleibt ungeklärt, ob die fiktive Figur Stanley auch die Fähigkeit hat, diese zu rezipieren, was gemäß den vorliegenden Ausführungen jedoch auch nicht relevant ist), ist die eines Kommentators aus dem Off. Dieser beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Tätigkeit des Kommentierens, sondern gibt vielmehr zu verstehen, wohin sich die Spielenden bzw. Stanley als nächstes bewegen sollten.
Selbstverständlich haben die Spielenden nun die Möglichkeit, dieser Anweisungen zu folgen, oder aber sie zu ignorieren und einen alternativen Weg einzuschlagen. Die Tatsache, dass sich das Immersionssubjekt in einer paradigmatischen Situation befindet, also selbst die Syntagmatik des Narrativs wählen kann, bildet die wichtigste Spielmechanik. Der Kommentator reagiert seinerseits auf die Entscheidungen, indem er sich – insbesondere bei Nichteinhalten seiner Empfehlungen – über Stanley aufregt, das Spiel an den Anfang zurücksetzt (wobei sich die Welt allerdings ändert) oder ad hoc Änderungen in der Spielwelt vornimmt. Daraus ergibt sich ein humoristisch brillant inszenierter Konflikt zwischen Spielenden/Stanley und dem Kommentator, der je nachdem, wie das Spiel gespielt wurde, zu einem von mehreren unterschiedlichen Enden führt. Dies ist im Grunde analog zur Situation in Frischs Roman, jedoch mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier das handelnde Subjekt nicht zum Scheitern – im Sinne von der Unmöglichkeit, innerhalb des Mediums frei zu handeln und nicht ‚festgeschrieben‘ zu werden – verurteilt ist. Schließlich ist das Subjekt hier ein Teil des Mediums, und nicht einfach ein Produkt desselben. Die Reaktionen der Stimme aus dem Off, die freilich auch über die Möglichkeit verfügt, die Spielwelt gemäß ihren Wünschen zu verändern, können wiederum zu unterschiedlichen Reaktionen der Spielenden führen, was ein hochkomplexes Konstrukt von Aktionen und Reaktionen nach sich zieht.
Die Tatsache, dass das Spiel dasjenige schafft, was der Erzählinstanz in einem Roman verwehrt bleibt, liegt daran, dass hier kein eigentlicher Autor und keine eigentliche Erzählinstanz vorliegen – obgleich dies mit der Stimme aus dem Off und der Figur Stanley suggeriert wird. Vielmehr handelt das Immersionssubjekt, das zugleich Teil von beidem, zugleich Produzent und Rezipient ist. Neben der Subversion der Erwartung sowohl von Linearität wie von Nicht-Linearität führt The Stanley Parable daher auch zwei dem (Computer-)Spiel inhärente Charakteristika vor, die sich schwer auf andere Medien übertragen lassen.
- Alles ist Entscheidung: Bei linearen Medien ist die Möglichkeit, als Entscheidende/r auf selbige Einfluss zu nehmen, beschränkt. Man kann sich entscheiden, das letzte Kapitel eines Buchs zuerst zu lesen, einige Seiten zu überspringen, einen Film vor- oder zurückzuspulen oder das Theater zu verlassen. Am Buch, am Film oder am Stück selbst ändert dies jedoch wenig. Beim Spiel steht dagegen die Entscheidung im Vordergrund; alles, was die Spielenden tun, ist eine Entscheidung ihrerseits. Von wichtigen oder als wichtig inszenierten moralischen Entscheidungen – beispielsweise in den Titeln des Entwicklerteams Telltale – bis zur Entscheidung, einen völlig irrelevant scheinenden Schritt nach links oder nach rechts zu tun. Auch wenn das Spiel selbst, wie auch The Stanley Parable, bisweilen nur zwei Möglichkeiten offenlässt, ist die Notwendigkeit, sich entscheiden zu müssen, essentiell und relevanter als der damit einhergehende Fort- oder Ausgang des Spiels. Wenngleich bei solchen narrativen Weggabelungen Assoziationen zu sog. ‚Choose Your Own Adventure‘-Büchern geweckt werden, bei denen an bestimmten Stellen im Plot von einer linearen Erzählung zu einer anderen gewechselt wird, so ist die Realität im Spiel eine andere. Die Tatsache, dass sich die Spielenden zu jeder Zeit mit einer vorgeschlagenen Linearität konfrontiert sehen, daraus aber mental eine sich kontinuierlich verändernde Virtualität erstellen können, ist essentiell. Die tatsächliche Anzahl der möglichen Verzweigungen der Geschichte ist dabei sekundär. Denn „[d]er Weg ist das Ziel und das Spiel hat seinen Reiz darin, den […] Weg zum (letztlich unbedeutenden) Ziel zu finden.“ 31
- Es gibt kein Richtig oder Falsch: Weil das Ziel unbedeutend ist, ergibt es keinen Sinn, in den Kategorien Richtig (also zu einem guten oder korrekten Ziel führend) und Falsch (zu einem falschen, inkorrekten Ziel führend) zu denken. Es gibt schlicht Entscheidungen bzw. Handlungen, die zu einem bestimmten Ausgang des Spiels – in Stanleys Fall einem der unterschiedlichen gescripteten Enden – führen, und es gibt andere, die dies nicht tun. Es gibt für die Story relevante Entscheidungen und irrelevante, Handlungen mit Konsequenzen und ohne. Dieser Umstand und die damit zusammenhängende Möglichkeit, ‚gegen das Spiel‘ zu spielen, sind nicht nur Teil des Spiels, sondern das Fundament der Interaktion überhaupt, bedeuten sie schließlich nicht weniger, als dass die Spielenden aus freien Stücken entscheiden können, was sie tun möchten (und was nicht). Obgleich die Spielenden bisweilen erwarten, ein Spiel richtig oder falsch spielen zu können – und mit einer entsprechenden Endsequenz belohnt zu werden –, gestaltet sich das Medium Spiel anders. Paradoxerweise verlangt die spielende Community selbst, nicht zuletzt um mehr Spiel für ihr Geld zu erhalten, von einem Titel häufig Wiederspielbarkeit, die jedoch an sich die Richtig-Falsch-Dichotomie unterminiert. Wenn sich ein Spiel mehrfach auf unterschiedliche Art mit einem anderen Ende durchspielen lässt, gibt es nicht nur eine richtige Art zu spielen. Besonders eindrücklich sind in diesem Zusammenhang sehr populäre Multiplayer-Shooter, bei denen wohl die wenigsten Gamer/innen für die Statistiken am Schluss eines Matches spielen. Sobald eine Runde vorbei ist, will man die nächste Runde beginnen; man spielt also nicht, um ein richtiges oder falsches Ziel zu erreichen, sondern schlicht, um zu spielen.
Zurück zu Stanley: Auch dieses Spiel hat nachvollziehbarerweise nicht beliebig viele Enden. Das programmierte Framework ist schließlich begrenzt. Dies spielt, wie erwähnt, auch keine entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass das Immersionssubjekt zu jeder Zeit dynamisch über den weiteren Fortgang entscheiden kann.
The Stanley Parable zeigt auf, dass Computerspiele nicht nur anders sind als traditionelle Medien, sondern aufgrund der Charakteristika des Immersionssubjekts partiell sogar als Weiterführung derselben verstanden werden können. Das Spiel transzendiert die Hindernisse, die das erzählte Subjekt linearer Medien davon abhalten, ein eigentliches, d.i. sich selbst kontinuierlich veränderndes Subjekt zu sein, indem es an die Stelle der Dichotomie Rezipient vs. Figur das Immersionssubjekt, also eine nicht-trennbare Kombination von beiden, setzt. Dieses modifiziert sich ständig durch die Notwendigkeit, unaufhörlich Entscheidungen zu treffen und somit zugleich Rezipient und Produzent des Spiels zu sein.
Glücklicherweise stehen sowohl die Praxis wie auch die Erforschung dieses jungen Mediums noch am Anfang. Es ist unbezweifelbar, das sich bereits in näherer Zukunft weitere narrative Potentiale des Computerspiels entfalten werden, die näherer Analyse bedürfen.
Verzeichnis der verwendeten Texte und Medien:
Literatur
Burch, Noël: Theory of film practice. Princeton: Princeton University Press 1981.
Dirksmeier, Peter: Der husserlsche Bildbegriff als theoretische Grundlage der reflexiven Fotografie: Ein Beitrag zur visuellen Methodologie in der Humangeografie. In: Social Geography. Jg 2007, H. 2, S. 1-10.
Frisch, Max: Ich schreibe für Leser. Antworten auf vorgestellte Fragen. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Bd. 5. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999, S. 323-334.
Frisch, Max: Mein Name sei Gantenbein. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Bd. 5. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999, S. 7-320.
Günzel, Stephan: Raum, Karte und Weg im Computerspiel. In: Distelmeyer, Jan; Hanke, Christine; Mersch, Dieter (Hg.): Game Over!? Perspektiven des Computerspiels. Bielefeld: Transcript 2008, S. 113-132.
Günzel, Stephan: The Space-Image. Interactivity and Spatiality of Computer Games. In: Günzel, Stephan; Liebe, Michael; Mersch, Dieter (Hg.): Conference Proceedings of the Philosophy of Computer Games. Potsdam: Universitätsverlag 2008, S. 170-188.
Günzel, Stephan: Raum - Körper - Medium. Zur bildtechnischen Variation der Liebwahrnehmung und -Steuerung am Beispiel von Computerspielen. In: Kilger, Gerhard; Müller-Kuhlmann, Wolfgang (Hg.): Raum und Körper – Körperraum. Kreativität und Raumschöpfung. Essen: Klartext 2009, S. 38-45.
Günzel, Stephan: Außerhalb des Bildes – das Off als Virtualität. In: Möller, Jan-Henrik; Stenagel, Jörg; Hipper, Lenore (Hg.): Paradoxalität des Medialen. Festschrift für Dieter Mersch. München: Fink 2013, S. 161-173.
Günzel, Stephan: Raum(bild)handlung im Computerspiel. In: Strohmaier, Alexandra (Hg.): Kultur – Wissen – Narration. Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften. Bielefeld: Transcript 2013, S. 489-509.
Günzel, Stephan: Vom Sehen des Sehens zum Sehen des sich selbst Sehens. Das Computerspielbild der ersten Person. In: Böhler, Arno; Herzog, Christian; Pechriggl, Alice (Hg.): Korporale Performanz. Zur bedeutungsgenerierenden Dimension des Leibes. Bielefeld: Transcript 2013, S. 123-154.
Jakobson, Roman: Linguistik und Poetik. In: Jakobson, Roman (Hg.): Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1979, S. 83-121.
Matt, Beatrice von: Mein Name ist Frisch. Begegnungen mit dem Autor und seinem Werk. München: Nagel & Kimche 2011.
Mukherjee, Souvik: Video games and storytelling. Reading games and playing books. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015.
Mul, Jos de: The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games. In: Goldstein, J.; Raessens, Joost (Hg.): Handbook of Computer Games Studies. Cambridge: Cambridge, MA: MIT Press 2005, S. 251–266.
Ricoeur, Paul: Zeit und Erzählung. 3 Bände. München: Fink 1988.
Schuppisser, Raffael: Von der Simulation zum Text. Narrative Strukturen in Computerspielen. Zürich: Chronos 2014.
Stiles, Victoria: Max Frischs Roman ‚Mein Name sei Gantenbein‘: Spiel mit Varianten. In: Modern Language Studies. Jg. 1980, H. 10, S. 82-87.
Taylor, Laurie: When Seams Fall Apart. Video Game Space and the Player. In: Game Studies Jg. 3, H. 2 (2003). <http://www.gamestudies.org/0302/taylor> [31.3.2016].
Computer- und Videospiele
Capybara Games: Super Time Force Ultra (Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation4, PlayStation Vita). 2014.
Daniel Mullins Games: Pony Island (Windows, Mac OS, Linux). 2015.
Galactic Cafe: The Stanley Parable (Microsoft Windows, Mac OS, Linux). 2013.
Maxis: SimCity (Windows, Lsinux, Mac OS, Wii, PlayStation u.a.). 1989.
Mojang: Minecraft (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS u.a.). Seit 2009.
Number None: Braid (Windows, Mac OS, Linux, Xbox Live Arcade, PlayStation 3). 2009.
Rockstar Games: Red Dead Redemption (Xbox 360, PlayStation3). 2010.
SUPERHOT Team: SUPERHOT (Windows, Mac OS, Linux, Xbox One). 2016.
Toby Fox: UNDERTALE (Windows, Mac OS). 2015.
- Günzel: Raum(bild)handlung im Computerspiel. 2013, S. 490. [↩]
- Vgl. Günzel: The Space-Image. 2008, S. 183; Günzel: Vom Sehen des Sehens zum Sehen des sich selbst Sehens. 2013, S. 124ff. [↩]
- Taylor: When Seams Fall Apart. 2002. <http://www.gamestudies.org/0302/taylor> [31.3.2016]. [↩]
- Vgl. Günzel: Raum, Karte und Weg im Computerspiel. 2008, S. 118. [↩]
- Vgl. Dirksmeier: Der husserlsche Bildbegriff. 2007, S. 3. [↩]
- Vgl. Ricoeur: Zeit und Erzählung. 1988. [↩]
- Vgl. Mul: The game of life. 2005. [↩]
- Taylor: When Seams Fall Apart. 2002. <http://www.gamestudies.org/0302/taylor> [31.3.2016]. [↩]
- Vgl. Günzel: Außerhalb des Bildes. 2013. [↩]
- Vgl. Burch: Theory of film practice. 1981, S. 17ff. [↩]
- Vgl. Günzel: Vom Sehen des Sehens zum Sehen des sich selbst Sehens. 2013, S. 132ff. [↩]
- Toby Fox: UNDERTALE. 2015. [↩]
- Daniel Mullins: Pony Island. 2015. [↩]
- SUPERHOT Team: SUPERHOT. 2016. [↩]
- Rockstar Games: Red Dead Redemption. 2010. [↩]
- Vgl. Schuppisser: Von der Simulation zum Text. 2014, S. 9ff. [↩]
- Vgl. Mukherjee: Video games and storytelling. 2015, S. 123ff. [↩]
- Mukherjee: Video games and storytelling. 2015, S. 127. [↩]
- Mukherjee: Video games and storytelling. 2015, S. 127. [↩]
- Number None: Braid. 2009. [↩]
- Capybara Games: Super Time Force Ultra. 2014. [↩]
- Vgl. Jakobson: Linguistik und Poetik. 1979. [↩]
- Mojang: Minecraft. 2009. [↩]
- Maxis: SimCity. 1989.[↩]
- Galactic Cafe: The Stanley Parable. 2013. [↩]
- Vgl. Mukherjee: Video games and storytelling. 2015. [↩]
- Vgl. Stiles: Spiel mit Varianten. 1980; Frisch: Ich schreibe für Leser. 1999. [↩]
- Vgl. Matt: Mein Name ist Frisch. 2011, S. 122. [↩]
- Frisch: Ich schreibe für Leser. 1999, S. 325. [↩]
- Frisch: Mein Name sei Gantenbein. 1999, S. 320. [↩]
- Günzel: Raum – Körper – Medium. 2009, S. 42. [↩]
