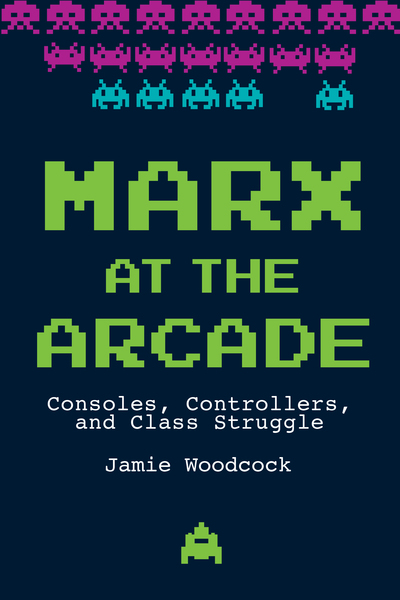
Karl am Controller. Buchrezension: Jamie Woodcock: Marx at the Arcade
Jamie Woodcock: Marx at the Arcade. Consoles, Controllers and Class Struggle. (Haymarket Books, London 2019), 15,99€; 208 Seiten.
Der Titel hat Wucht: „Marx at the Arcade“. Wer hier eventuell noch Zweifel hat, in welche ideologische Richtung das Buch weisen könnte – es könnte ja auch ironisch gemeint gewesen sein? – den klärt der Untertitel unmittelbar auf: „Consoles, Controllers and Class Struggle”. Das vom jungen britischen Soziologen Jamie Woodcock geschriebene knapp 170 Seiten lange Buch erschien 2019 im Verlag „Haymarket Books“, ein Verlag der es sich zum Ziel gesetzt hat "to be a socialist workplace in a capitalist world".1 Jamie Woodcock hat davor schon ein Buch über seine Undercover-Erfahrungen in einem Callcenter geschrieben und ist außerdem Mitherausgeber der „Notes from Below“, laut eigenen Angaben eine „publication that is committed to socialism, by which we mean the self-emancipation of the working class from capitalism and the state.”2 Ach ja und dann ist Woodcock auch Mitherausgeber des Historical Materialism Journal. Nur damit da keine Missverständnisse entstehen, es ist furchtbar erfrischend einen politischen Text zu lesen, der so ehrlich zu seiner ideologischen Perspektive steht. „Marxists should be interested in videogames“ schreibt Woodcock in seiner Einleitung und: „videogame players can benefit from adopting a Marxist analysis.“ (S.8) In seinem Buch wird der Autor entsprechend in einem ersten Teil die Videospielproduktion und in einem zweiten Teil das Videospielen selbst aus einer marxistischen Perspektive analysieren. Spoiler: Der erste Teil ist sehr viel besser.
So fängt der erste Teil überraschend stark an. Nach der obligatorischen Anrufung Johan Huizingas und Roger Caillois, führt Woodcock seine Analyse der Spieleindustrie mit einer kurzen Geschichte digitaler Spiele ein, wie wir es von vielen Büchern zu Videospielen gewohnt sind. Allerdings begnügt sich Woodcock, vermutlich auch bedingt durch seine Sozialisierung mit Videospielen im Großbritannien der 1980er und 1990er Jahre, eben nicht einfach damit die gewohnten „Erfolgsgeschichten“ von Atari, Nintendo, Electronic Arts, zu reproduzieren. Als einer von wenigen Autoren – im deutschsprachigen Raum wäre hier zum Beispiel Claus Pias zu nennen – gräbt er etwas tiefer. Woodcock erzählt vom Nimatron (1940) und Claude Shannons Konzept eines Schachcomputers (1950), Arthur Samuels Checkers (1956) und Alex Bernsteins Schachprogramm (1957) (S. 18-20). Im Gegensatz zu Steven Kent und seinen Epigonen reduziert er Computerspielgeschichte nicht auf eine Erzählung erfolgreicher Unternehmen, sondern inkludiert auch die häufig übersehenen Kleinprojekte und Gedankenexperimente abseits des Marktes. Er wirft einen ersten Blick auf die aktive Hacker- und DIY-Szene, schreibt also nicht nur von Atari und dem Video Game Crash sondern auch von kleinen Newslettern, über die in BASIC geschriebene Spielecodes vertrieben wurden. In der Tradition von Nick Dyer-Witheford und Greig de Peuter zeichnet er die wechselseitigen Beziehungen digitaler Spiele und des „military-academic-industrial-complex“ nach: Viele der ersten Spiele wurden zum Beispiel an Großrechnern entwickelt, die eigentlich im Dienste von Rüstungsprojekten eingesetzt wurden. Das Arpanet, der militärische Vorläufer des Internet wurde zur Verbreitung von Spielen genutzt (S. 21).
Der größte Teil des ersten Abschnitts ist aber einem aktuellen Blick auf die „videogame industry“ gewidmet, eine ausführlich gewollte Bestandsaufnahme. Natürlich stößt der Autor hier auch an Grenzen: Hauptaugenmerk liegt auf der europäischen und amerikanischen Spielindustrie und nicht auf den jungen Spielgiganten aus der Volksrepublik China, obwohl die drei umsatzstärksten Spiele (jeweils mehr als eine Milliarde Dollar) vom chinesischen Publisher Tencent vertrieben werden (S. 38). Allerdings ist der fokussierte und gründliche Blick auf das Vereinigte Königreich und die USA auch eigentlich die Stärke des Buches. Hier kann er exemplarisch die Rolle der Videospielindustrie innerhalb des Kapitalismus nachzeichnen (S. 43), und das Videospiel als „Ware“ im marxistischen Sinne begreifen (S. 47). So kann er zum Beispiel einleuchtend erklären, warum Downloadtitel, trotz der geringeren Produktions- und Vertriebskosten, nach wie vor teurer als Spiele auf physischen Datenträgern sind: „The majority of profits are made on videogames in the weeks after they are launched, making product placement in physical locations key“ (S. 49). Wieder geht er auf das Näheverhältnis zwischen Spielindustrie und Militär ein. Insbesondere Shooter und Strategiespiele helfen indem sie Militäraktionen „normalisieren“. So erklärt sich auch die reibungslose Zusammenarbeit mit unzähligen „military consultants“ bei Spielreihen wie Call of Duty (S. 55). Hierzu zitiert einen Mitarbeiter „We’ve been fortunate that the series has a lot of fans across military organization , and within the entertainment industry” (S. XX). Weiters kommt er auf die extensive Nutzung von lizenzierten Darstellungen realer Feuerwaffen in Spielen zu sprechen und bringt abschließend das Beispiel eines Autors der Call of Duty-Reihe der auch in einem Think Tank mitarbeitet, der Beratung zu „future unkknown conflicts“ anbietet (S. 58).
Das bisher Gesagte finden wir so ähnlich bereits bei Dyer-Whiteford und de Peuter. Nun aber folgen die vielleicht spannendsten Einblicke des Buches in die Arbeitswelt von Spieleentwickler*innen im Vereinigten Königreich und den USA. So berichtet Woodcock von der gängigen Praxis alle Mitarbeiter*innen mittels „Non Disclosure Agreements“ zu knebeln – „this level of security is usually reserved for working for a spy agency“ (S. 65), die nicht nur zum psychologischen Stress für Mitarbeiter*innen beisteuern sondern auch jede Form von Organisation der Arbeiter*innen erschweren. In Analogie zu Karl Marx‘ Rückgriffen auf die Berichte von „Factory Inspectors“ arbeitet sich der Autor durch alle ihm zur Verfügung stehenden Statistiken und Erfahrungsberichte und kommt zu folgenden ersten Ergebnissen:
„First, the labor process can be complex and deeply interconnected, without necessarily having clearly defined job descriptions and functions. This can make it difficult to clearly demarcate management and labor, particularly if individuals do not confront each other as buyers and sellers of labor power. Second, in this creative work, there may not be stable forms of work with clear boundaries, meaning that traditional notions of the wage-effort bargain may not be effective. Third, the workplace itself may be less defined, without the strict timeframes and distinctions between play and work” (S. 77).
Hier begegnen wir einer der Kernaussagen des Buches. Da die gesamte Industrie in einem Milieu entstand, dass Lohnarbeit ablehnte entwickelten sich ironischerweise aus dieser Abwehrhaltung heraus extrem ausbeuterische Arbeitsverhältnisse: Crunch Time, das heißt bis zu 40 unbezahlte Überstunden pro Woche, die gang und gäbe sind (S. 82) und eine extrem uniforme, das heißt weiße männliche Arbeiterschaft (S. 88). Daran anschließend daran Woodcock von aktuellen Versuchen zur Gründung einer internationalen Gewerkschaft – Game Workers Unite (GWU). Die Initialzündung dazu war neben einem Streik in Frankreich eine Podiumsdiskussion bei der Game Developpers Conference 2018 (S. 95) und hier vor allem auch die Einschüchterungstaktiken der International Game Developer Association welche der Idee jeglicher Gewerkschaftsgründung gegenüber extrem feindlich eingestellt waren.
In einem zweiten Teil widmet sich der Autor ergänzend einer kulturwissenschaftlichen Analyse Digitaler Spiele und untersucht dazu First Person Shooter, Rollenspiele, politische Spiele und Onlinespiele. Die Idee hier eben entgegen einer bisherigen Tradition auch Kultur abseits des materiellen Lebens nach marxistischen Kriterien zu analysieren ist spannend, bleibt aber großteils sehr oberflächlich. So sind zwar erste Gedanken zu einem populärkulturellen „postmemory“ (118) sowie die Betrachtungen zur Mitarbeit des verurteilten ehemaligen Militärs Oliver North an der Call of Duty: Black Ops-Reihe (119) sehr spannend, der Autor zieht aber aus den vereinzelten Betrachtungen keine synthetischen Schlüsse. Ähnlich verhält es sich mit den Kapiteln zu Rollenspielen und politischen Spielen. Es handelt sich in den drei Fällen mehr um erste Betrachtungen, die noch einer Analyse oder gar Interpretation entbehren. Etwas spannender ist das kurze Kapitel zu „Online Games“, in welchem Woodcock einige interessante Beobachtungen zu antifeministischen und misogynen Spielkulturen trifft.
Die Schlussbetrachtungen sind kurz und überzeugen. Woodcock kommt ein letztes Mal darauf zu sprechen wie aus einer „frivolity“ - dem Spiel - eine ungehemmte kapitalistische Ausbeutungsindustrie werden konnte. Er zitiert Ian Williams, dem zufolge „ the exploitation in the video game industry provides a glimpse at how the rest of us may be working in years to come”. (S. 160) Sowohl die Spielentwicklung als auch die Spiele selbst entstanden großteils abseits zu der gewohnten dominanten (Arbeits-)Kultur. Aus einem anfänglich rebellischen Impuls – aus einer Gegenbewegung – konnte sich aber so ungehemmt von allen sozialen Sicherheitsnetzen zum einen toxische Arbeistverhältnis, zum anderen aber auch eine teilweise toxische Spielekultur entwickeln.
Insgesamt lässt sich sagen, dass Woodcock bewusst marxistischer Zugang zu Videospielen mehr essayistische Beobachtung ist als wissenschaftliche Analyse. Vieles von dem was er schreibt findet man bereits bei anderen Autor*innen, allerdings ergänzt der Autor bestehende Erkenntnisse um seine persönliche Erfahrungen, was anlässlich der Arbeitsbedingungen innerhalb der Industrie insbesondere aber anlässlich der ersten Versuche eine Gewerkschaft zu gründen hochgradig relevant ist.
